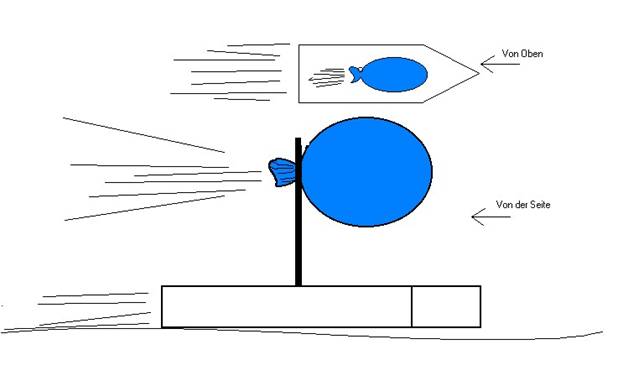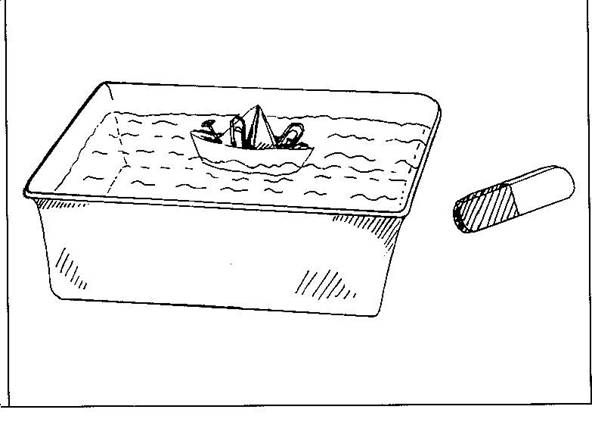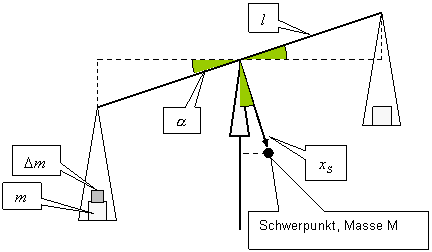|
Ort: Experimentierraum
oder im Freien
|
Zeit: ca 20 Minuten
|
Materialien/Vorbereitung:
Verschiedene
Gegenstände und Materialien aus dem Erlebnisbereich des Kindes wie:
Knöpfe, Styropor, Zahnstocher, Reißzwecken, Korken, Knete, Spielfiguren,
Wasser, Schüsseln usw.
|
|
Ziele für die Kinder:
-
Die Kinder können sehen, welche Materialien oben schwimmen, welche nicht.
-
Die Kinder sollen die Materialien vorsichtig auf die Wasseroberfläche
legen, damit auch schwerere Materialien ausprobiert werden können.
-
.
|
Ablauf:
Wenn die Schüsseln auf dem Tisch stehen, können sich
die Kinder die verschiedenen Materialien nehmen und sie aufs Wasser
legen und sehen, welche Materialien schwimmen und welche nicht.
Eine Problematisierung ist möglich, z.B. wie schaffe
ich es die Knete zum Schwimmen zu bringen (aus der Kugel ein Schiff
formen)
|
|
Wissenschaftlicher Hintergrund:
Ob
Gegenstände schwimmen können, oder nicht, hängt vom Verhältnis zwischen
Auftrieb und Gewichtskraft ab. Taucht man einen Gegenstand in Wasser
ein, können verschiedene Fälle auftreten:
Auftrieb
< Gewichtskraft = Der Körper sinkt.
Auftrieb
= Gewichtskraft = Der Körper schwebt.
Auftrieb
> Gewichtskraft = Der Körper steigt hoch und schwimmt.
Bei
massiv ausgefüllten Körpern (wie Holzkugel, Vollgummi-Ball, Korken etc.)
bestimmt allein die Dichte der Gegenstände (d.h. wie viel Gramm ein
Kubikzentimeter eines
Körpers wiegt) im Vergleich zur Dichte der Flüssigkeit, ob der Gegenstand
in der Flüssigkeit schwimmt oder untergeht. Ist die Dichte des Materials
geringer als die Dichte der Flüssigkeit, schwimmt der Körper.
Bei
vielen schwimmenden Körpern (wie Schiffen, Bällen, leeren Flaschen,
etc) kommt zusätzlich die Form ins Spiel. Entscheidend dabei ist, dass
die Körper viel Wasser beim Eintauchen verdrängen, ohne dass Wasser
in sie eindringt. So auch beim obigen Versuch: Das Knetgummi-Boot verdrängt
deutlich mehr Wasser als ein aus demselben Material geformter Knetgummi-Ball.
|
Variationen:
Den
Kindern wird erzählt, was wir machen wollen: Heute ist großer Schwimm-
und Tauchtag. Wir wollen testen, welche Gegenstände schwimmen können
und welche untergehen. Es werden zwei bis drei Schüsseln auf den Tisch
oder draußen auf den Boden gestellt und vorher mit Wasser gefüllt.
Die
Kinder können sich Styroporboote bauen und schauen ob sie schwimmen.
Wenn ja können sie die Boote noch beladen und schauen, wann diese untergehen.
|
|
Hinweise:
Auf der Wasseroberfläche ist eine Haut, die nicht so schwere Materialien
auf der Wasseroberfläche hält.
|
Quellenangabe:
http://www.physik.uni-kassel.de/did/gs/Schiff.htm
Carolin Schneider & Bastian Fleck
Spannende Experimente von Herrmann Krekeler und Marlies
Kieper- Bastian. Ravensburger Verlag.
|