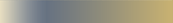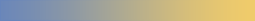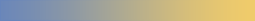Entwicklungspsychologische,
kognitionspsychologische und neurophysiologische Voraussetzungen für die
Hinführung zu naturwissenschaftlichen Phänomenen im frühen Kindesalter
Nicht erst seit den Ergebnissen der Pisa-Studie wird eine
kontroverse Diskussion über das mangelnde Interesse unserer Schülerinnen und
Schüler an naturwissenschaftlichen Fächern geführt. Inhalte aus den Bereichen
Chemie und Physik z. B. haben im Sachkundeunterricht im Vergleich mit
beispielsweise sozialwissenschaftlichen Themenbereichen eine immer geringere
Bedeutung. In weiterführenden Schulen wird Chemie und Physik erst im 7. oder 9.
Schuljahr angeboten. Zu spät, meinen viele Kritiker, da die Jugendlichen in der
Phase der Pubertät andere Interessen entwickeln und fordern konsequenterweise
schon im Vorschulalter eine Begegnung mit naturwissenschaftlichen Fragen, da
gerade Kinder in dieser Entwicklungsphase für diese Phänomene besonders empfänglich
sind.
Dies führt zwangsläufig zu der zentralen Frage, ob
Kindern im Vorschulalter ein ihrem Alter entsprechender Zugang zu
naturwissenschaftlichen Phänomenen überhaupt möglich ist und ob und auf welche
Weise die Vermittlung frühkindlicher Naturwissenschaftserfahrung in
Kindertagesstätten sinnvoll erscheint.
Um diese Frage zu beantworten, ist eine Auseinandersetzung
mit entwicklungspsychologischen, kognitionspsychologischen und
neurophysiologischen Erkenntnissen unerlässlich. Eine Aufarbeitung des
aktuellen Forschungsstandes zu Alltagsvorstellungen von Kindern im frühen
Kindesalter findet sich u.a. ausführlich in der vielbeachteten Arbeit von G.
Lück, in der sie mit Kindern im Vorschulalter mit Hilfe von Experimenten Phänomene
aus der unbelebten Natur betrachtet und Erklärungsmuster dafür entwickelt.
Piagets Entwicklungs- und Kognitionspsychologie
Betrachtet man die Diskussion um die geistige Entwicklung im
Kindesalter, dann begegnet man immer wieder Hinweisen auf Piagets Entwicklungs-
und Kognitionspsychologie.
Angesichts der unterschiedlichen Gewichtungen von Piagets
Untersuchungsergebnissen und der unüberschaubaren Menge an Sekundärliteratur
mit ihrer segmenthaften Betrachtungsweise seiner Forschungen, soll hier
lediglich auf die Bedeutung der kognitiven Entwicklungstheorie Piagets für das
Kindergarten- und Vorschulalter sowie die Relevanz für frühkindliche
Naturwissenschaftserfahrung eingegangen werden.
Das Kleinkind- und Vorschulalter der 2-7-jährigen wird bei
Piaget mit der Präoperationalen Phase erfasst. Das Denken ist noch voll von
logischen Irrtümern, da das kindliche Denken mehr von der Wahrnehmung als von
der Logik beherrscht wird. Es wird dem Kind jedoch zunehmend möglich, sich
komplette Handlungen auf gedanklicher Ebene zu vergegenwärtigen, wenn diese
Handlungen bereits im "echten Leben "ausgeführt wurden.
In dieser Phase entwickelt sich das begriffliche Denken. Das
Kind ist jedoch noch nicht in der Lage sämtliche Eigenschaften dieser Begriffe
zu verstehen. So identifiziert es z.B. alle männlichen Wesen für einige Zeit
als "Papa" und alle weiblichen Wesen als "Mama". Das Kind
kann also Objekte identifizieren; sein Verständnis ist jedoch unvollständig, da
es noch nicht zwischen scheinbar identischen Mitgliedern derselben Begriffe
unterscheiden kann. Daher der Terminus "vorbegrifflich".
In dieser Phase der Entwicklung vermuten Kinder in vielen
Dingen, wie in dem Mond, der Puppe oder anderen Gegenständen des täglichen
Lebens etwas Lebendiges. Diese "Beseelung" (Animismus), in der Kinder
leblosen Gegenständen übernatürliche, magische Eigenschaften zuschreiben, ist
ein wichtiges Merkmal der frühen Präoperationalen Phase ebenso wie die
Schwierigkeit von der eigenen persönlichen Perspektive abzurücken und sich in
die Sichtweise anderer hineinzuversetzen (Egozentrismus).
Für die Beantwortung der Frage, ob Kindern im Vorschulalter
ein ihrem Alter entsprechender Zugang zu naturwissenschaftlichen Phänomenen
überhaupt möglich ist, scheint besonders die Tatsache wichtig zu sein, dass es
vier- bis siebenjährigen Kindern kaum gelingt Invarianzen zu erfassen.
"Dies gilt für die Invarianz der Substanz, des Gewichts und des Volumens
fast gleichermaßen ..." .
Ein bekanntes Beispiel für die Invarianz flüssiger Quantitäten ist das
Experiment mit zwei Bechern. Dem Kind werden zwei identische Becher gezeigt,
die bis zur gleichen Höhe mit Wasser gefüllt sind. Dann wird der Inhalt des
einen Bechers in eine lange dünne Röhre geschüttet. Das Kind, das beim ersten
Mal zugab, dass die Mengen in beiden Bechern gleich seien, wird nun gefragt, ob
in dem neuen Behälter genauso viel, mehr oder weniger Wasser ist. Im intuitiven
Stadium (anschauliches Denken) wird es fast immer sagen, es sei mehr, weil es
in der Röhre viel höher stehe. Mit anderen Worten, das Kind achtet auf die
irreführenden Wahrnehmungsmerkmale der Reizsituation.
Allerdings beginnt das Kind in der Phase des anschaulich-intuitiven
Denkens bereits sukzessiv Invarianzen zu erfassen. In diesem Prozess der
nacheinander erworbenen Fähigkeit des Erkennens von Invarianzen löst sich das
Kind allmählich auch von seinem Egozentrismus.
Fasst man die bisherigen Ausführungen zusammen, so scheint
das präoperationale Denken des Kindes eher gegen eine frühe Hinführung zu
wissenschaftlichen Phänomenen zu sprechen. G.Lück führt jedoch eine Reihe von
Argumenten an, die eine Hinführung zu naturwissenschaftlichen Phänomenen im
späten Kindergarten- und Vorschulalter (5-6½ Jahren) dennoch sinnvoll
erscheinen lassen.
Piaget selbst weist darauf hin, dass bereits einige
Fünfjährige und noch mehr Sechsjährige die Fähigkeit erworben haben, bestimmte
Invarianzen zu erkennen,
so dass man davon ausgehen kann, dass die Kinder auch in der Lage sind
weitergehende logische Überlegungen anzustellen und so z.B. bestimmte
Eigenschaftsmerkmale von unbelebter Natur sinnvoll zu erfassen.
G.Lück stellt fest, dass für die Auseinandersetzung mit
naturwissenschaftlichen Phänomenen ein bestimmter Entwicklungsstand erreicht
werden muss, nämlich "die Wahrnehmung der Veränderungen aufgrund der
zunehmenden Ausbildung der Dezentrierung, die zu den entsprechenden
Adaptionsprozessen führt...".
D.h., die Aufmerksamkeit richtet sich nicht mehr nur auf einen einzigen
Gegenstand oder Merkmal, sondern das Kind ist zunehmend in der Lage, mehr als
einen Wahrnehmungspunkt zu berücksichtigen.
G. Lück verweist in diesem Zusammenhang auf unterschiedliche
Auffassungen zu Piagets Stadientheorie. Einige Autoren argumentieren gegen die
starren Altersangaben in der Stadientheorie und begründen dies mit dem
methodischen Vorgehen Piagets bei der Ermittlung des jeweiligen Alters der
Kinder, dem Einfluss der Medien, die zur einer Beschleunigung der geistigen
Entwicklung beitragen und der Erkenntnis, dass Kinder schon früher als von
Piaget ermittelt kognitive Fähigkeiten der operationalen Phase entwickeln, wenn
die gestellten Aufgaben von konkreten Lebenssituationen der Kinder ausgehen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass "kognitive
Entwicklungen nicht gleichzeitig in allen Bereichen in Abhängigkeit von
Entwicklungsstadien ablaufen, sondern dass sich der Erwerb von Wissen in
spezifischen Inhaltsbereichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen
Sequenzen vollzieht".
Elsbeth Stern vom Max-Plank-Institut für Bildungsforschung in Berlin wendet
sich ebenfalls vehement gegen die Stufentheorie Piagets. Sie konnte in mehreren
Versuchen nachweisen, dass Kinder viel früher als in Piagets Theorie
beschrieben physikalische Gesetze verstehen können. So waren Viertklässler
beispielsweise in der Lage das Prinzip der Dichte als Masse pro Volumen zu
erfassen und in einem Koordinatensystem darzustellen.
Folgt man dieser Argumentation, dann lässt sie eine Begegnung mit
naturwissenschaftlichen Fragen im Vorschulalter sinnvoll erscheinen.
Ein weiterer Einwand gegen Piagets Erkenntnistheorie liegt
in der Tatsache begründet, dass sie affektive und emotionale Aspekte völlig
außer Acht lässt. Dabei haben gerade ästhetische Gesichtspunkte, sinnliche
Wahrnehmung sowie die Freude am Experimentieren eine entscheidende Bedeutung
für die ersten Kontakte mit der unbelebten Natur.
Aus diesem Grunde ist es wichtig sich mit der
Entwicklungspsychologie Eriksons zu befassen, da dieser gerade den affektiven
Aspekten eine zentrale Bedeutung bei der menschlichen Entwicklung beimisst.
Der entwicklungspsychologische Ansatz von Erik H. Erikson
In Eriksons
entwicklungspsychologischem Ansatz ist die Identitätsbildung als Hauptproblem
und Hauptaufgabe des Individuums definiert.
Die wichtigsten Merkmale der individuellen Identitätsentwicklung sind nach
Erikson die psychosexuellen und psychosozialen Entwicklungskrisen und ein Gefühl der
inneren Einheit (Identitätsgefühl), dass sich jedes Mal neu nach der
erfolgreichen Bewältigung der jeweiligen psychosozialen Krise ( Autonomie gg.
Scham und Zweifel, Initiative gg. Schuldgefühl etc.) in einer Phase einstellt.
Erikson orientiert sich bei seiner Vorstellung von einer gesunden
Persönlichkeit an Marie Jahoda, wonach die gesunde Persönlichkeit ihre Umwelt
aktiv meistert, eine gewisse Einheitlichkeit zeigt und imstande ist, die Welt und
sich selbst richtig zu erkennen".
Das Wachstum einer Persönlichkeit folgt einem inneren 'Grundplan',
"dem die einzelnen Teile folgen, wobei jeder Teil eine Zeit der
Übergewichts durchmacht, bis alle Teile zu einem funktionierenden Ganzen
herangewachsen sind". Dieses
Wachstum erfolgt in acht Entwicklungsstadien, die jeweils durch entsprechende
"Entwicklungskrisen" gekennzeichnet sind:
I.
Säuglingsalter (Urvertrauen gg. Misstrauen)
II.
Kleinkindalter (Autonomie gg. Scham und Zweifel)
III.
Spielalter (Initiative und Schuldgefühl)
IV.
Schulalter (Werksinn gg. Minderwertigkeitsgefühl)
V.
Adoleszenz (Identität gg. Identitätsdiffusion)
VI.
Frühes Erwachsenenalter (Intimität gg. Isolierung)
VII.
Erwachsenenalter (Generativität gg. Selbst- Absorption)
VIII.
Reifes Erwachsenenalter (Integrität gg. Lebens-Ekel)
Für unsere Fragestellung ist das "Spielalter", das
in etwa dem Kindergarten- und Vorschulalter entspricht, von besonderem
Interesse.
Das Kind entwickelt in dieser Phase über die Krise seine
Identität Schritt für Schritt weiter. Es beginnt über sich selbst nicht
mehr in der dritten Person zu reden. Das Kind begibt sich auf die Suche
und erkundet seine Umwelt; dabei entfaltet das freie Spiel seine besondere Qualität. Es bietet dem Kind die
Möglichkeit die Welt im wörtlichen Sinne zu 'begreifen'. "In
diesem Stadium kommen ihm drei kräftige Entwicklungsschübe zu Hilfe, die jedoch
auch die nächste Krise beschleunigen: 1. das Kind lernt sich freier und
kraftvoller zu bewegen und gewinnt dadurch ein weiteres, ja, wie es ihm
scheint, ein unbegrenztes Tätigkeitsfeld; 2. sein Sprachvermögen vervollkommnet
sich soweit, dass es sehr viel verstehen und fragen kann, aber auch um so mehr
missversteht; 3. Sprache und Bewegungsfreiheit zusammen erweitern seine
Vorstellungswelt, so dass es sich vor seinen eigenen, halb geträumten, halb
gedachten Bildern ängstigt (...) Es lernt jetzt eminent eindringlich und
energisch: Über seine eigenen Grenzen hinaus und zu künftigen Möglichkeiten
hin" und dabei entwickelt es "eine unersättliche Wissbegier."
Die Grundstärke in dieser Phase ist die Kraft des
entschlossen Handelns, die im Spiel realisiert wird nicht ohne Grund nennt
Erikson diese Phase Spielalter".
Was tut das Kind, um sich in der
Welt zurechtzufinden? Zunächst sucht es nach idealen Leitbildern. Dies sind in
der Regel die Eltern, die als groß und mächtig wahrgenommen werden. Berufsrollen
wie Polizist, Feuerwehrmann, Lokomotivführer oder Astronaut werden interessant.
Diese idealen Rollen werden, ergänzt durch die eigene Phantasie, im
wesentlichen aus Bilderbüchern, Märchen und aus diversen anderen Medien, insbesondere
aus Fernsehsendungen übernommen. Im gemeinsamen Spiel mit den anderen Kindern
können diese Rollen dann interaktiv ausgelebt werden. Unterstützt
wird die Initiative der Kinder durch zunehmende Mobilität, körperliche Geschicklichkeit,
Sprachvermögen, kognitive Fertigkeiten und Phantasie."
Gisela Lück plädiert dafür diese Phase der Wissbegier
auszunutzen und die Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter zu
naturwissenschaftlichen Themen hinzuführen. Dafür scheint das Experimentieren
mit der unbelebten Natur im "Spielalter" besonders geeignet zu sein,
da die Kinder hier ihre gerade erwachenden Fähigkeiten wie Rekonstruieren,
Deuten, in Beziehung setzen etc. besonders erproben können. Die damit
verbundenen Erfolgserlebnisse bieten für die Kinder die Chance die bei den
Experimenten erlebte positive Grundstimmung gegenüber naturwissenschaftlichen
Phänomenen weiter zu festigen und tragfähig zu gestalten.
Der Umgang mit technischen Phänomenen sollte an die
Vorstellungen und Erfahrungen der Kinder anknüpfen. Erst in der aktiven Auseinandersetzung
mit der Umwelt, aus den Handeln heraus entwickeln sich Denkprozesse, die die
Vorstellungen der Kinder über technische Zusammenhänge erweitern können.
Kornelia Möller, die sich mit der Vermittlung von Technik im
Sachunterricht für das Grundschulalter beschäftigt, orientiert sich ebenfalls
an diesen Erkenntnissen wenn sie auf die kognitionspsychologischen Arbeiten von
Aebli verweist. Nach Möller erwerben die Kinder im aktiven Umgang mit
technischen Gegenständen und Vorgängen ein erstes, oft noch wenig bewusstes
Umgangswissen, das auch als Wenn-Dann-Wissen bezeichnet werden kann. Allerdings
reiche das Handeln nicht aus; erst "die Bewertung des Prozesses und der
Ergebnisse, das Korrigieren, Optimieren und Schlussfolgern, insgesamt also das
Reflektieren des Handelns" führen im Grundschulalter zum Verstehen und
Gelingen von technischen und naturwissenschaftlichen Experimenten.
Neurophysiologische Aspekte
Verfolgt man die rasante Entwicklung der Neurophysiologie
in den letzten Jahren, dann stellt sich die Frage, ob nicht auch Erkenntnisse
aus dem Gebiet der Neurophysiologie bzw. Neurobiologie für unsere Frag
estellung hilfreich sein könnten. Obwohl noch viele Fragen offen sind, beginnen
NeurowissenschaftlerInnen zunehmend besser zu verstehen, was sich im Gehirn
beim Lernen verändert.
Die wichtigsten
Bausteine des Gehirns sind die Neuronen (Nervenzellen). Diese hoch spezialisierten
Zellen empfangen aus mehreren Quellen elektrochemische Impulse. Wenn die Summe
dieser Impulse einen bestimmten Wert übersteigt, lösen sie ihrerseits einen
Impuls aus, der von einem benachbarten Neuron empfangen wird. Die Forscher
sagen: Das Neuron feuert. Die Kontaktstellen, an denen die Impulse von den benachbarten
Neuronen aufgenommen werden, nennt man Synapsen.
Schon bei der Geburt enthält das Gehirn potentiell alle
Voraussetzungen zum Denken und Lernen. 70% der Gehirnkapazität stehen dem
Lernen zur Verfügung, lediglich 30% sind von vornherein für bestimmte Dinge
festgelegt. In den ersten fünf bis sechs Lebensjahren wird das menschliche Gehirn
massiv umgestaltet. Ein Netzwerk von 20 Milliarden Nervenzellen reagiert sehr
flexibel auf jede Art von Eindrücken, Bildern und Informationen, indem es die
Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen (Synapsen) verändert. Während solcher prägungsähnlicher
Lernprozesse, werden mit Hilfe von chemischen Botenstoffen (Neurotransmitter)
die elektrischen Impulse von einer Nervenzelle zur nächsten übertragen. Jede
Nervenzelle verfügt über einen Sender und eine Vielzahl von Empfängern, mit
denen sie die Informationen der anderen Nervenzellen aufnimmt. Das Gehirn
verarbeitet diese Informationen zu neuen Strukturen, oder vernetzt diese mit
anderen, schon vorhandenen Strukturen. Dabei werden bestimmte Neuroverbindungen
verstärkt, andere abgeschwächt, andere verschwinden ganz. "Diese Abnahme
der Anzahl der Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen ist kein Verlust,
sondern es ist eine Selektion. Es werden die Verschaltungen gefestigt, beibehalten,
die passend sind, die auch dazu gehören. Und die durch den Dialog des
kindlichen Gehirns mit der Umwelt bestätigt werden, die gebraucht werden."
Das bedeutet, dass es in den verschiedenen Phasen der frühkindlichen
Entwicklung bestimmte Zeitfenster oder "sensitive Phasen" gibt, in
denen Informationen mit viel höherer Geschwindigkeit und Wirksamkeit als in
späteren Phasen aufgenommen werden. Kinder sind in diesen Phasen für spezielle
Einflüsse besonders empfänglich. So werden sich die Bereiche im Nervensystem,
die z.B. für Musik oder Sprachen zuständig sind im Vergleich mit anderen
deutlich stärker entwickeln, wenn das Kind von früher Kindheit an mit Musik
konfrontiert wird oder zweisprachig aufwächst. Es ist naheliegend, dass es auch
eine "sensitive Phase" für naturwissenschaftliche Fragestellungen
geben könnte. Diese Strukturierungsprozesse sind im Wesentlichen mit der
Pubertät abgeschlossen, danach steht dem Erwachsenen nur noch das bis dahin
gebildete Netzwerk zur Verfügung, in das das Erlernte vorrangig eingebettet
wird.
Zusammenfassung
Fasst man die entwicklungspsychologischen,
kognitionspsychologischen und neurophysiologischen Aspekte zusammen,
dann scheint die Vermittlung frühkindlicher Naturwissenschaftserfahrung
im Vorschulalter durchaus möglich und sinnvoll zu sein. Diese Erkenntnis wird
von immer mehr ForscherInnen gestützt. Sie weisen auf das frühe Interesse von
Vorschulkindern an naturwissenschaftlichen Phänomenen hin und befürworten einen
möglichst frühen, ihrem Alter entsprechenden Zugang zu naturwissenschaftlichen
Phänomenen.
Kinder brauchen anscheinend Lernprozesse, die anspruchsvoll
und ganzheitlich angelegt sind und in denen Geist, Psyche und Körper
gleichermaßen beansprucht werden. Lernen gelingt nachhaltiger, wenn die Inhalte
der Experimente aus dem unmittelbaren Erfahrungsbereich der Kinder kommen, in
verschiedenen Zusammenhängen auftauchen, in denen möglichst viele Sinne angesprochen
werden und von den Kindern selbst durchgeführt werden. Zusätzliche Motivation
erzeugen die Lernsituationen, in denen viel gelobt wird und bei denen ein
positives Klima herrscht. Gerade im Vorschul- und Grundschulalter sollte man
den Einfluss von sozialen Vorbildern, wie Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen
nicht unterschätzen. Die Art und Weise wie sie bestimmte Interessen
ausstrahlen, wie liebevoll mit den Kindern umgehen und wie vielfältig sie die
Körpersprache einsetzen, hat entscheidenden Einfluss auf das kindliche Lernen.